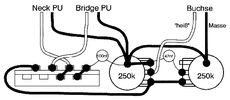So kenne ich das auch. Das Lautstärkepoti ist direkt mit dem Tonpoti verbunden, wird also niemals aus dem Signalweg genommen. Nach Duchossoirs Text sollte es eigentlich anders sein.
Allerdings dürfte die Klangregelung in der vorderen Position ziemlich wirkungslos sein. Ein Kondensator von 0,1 µF liegt ja bereits parallel zum Tonabnehmer und verschiebt dessen Resonanzfrequenz in den unteren Mitteltonbereich. Am Linksanschlag des Tonreglers wird ein zweiter Kondensator mit dem halben Wert dazu parallel geschaltet. Die Resonanzfrequenz sinkt dadurch lediglich um den Faktor 1,225, was zwischen großer und kleiner Terz liegt. Zum Ausgleich verringert sich die ohmsche Belastung des Tonabnehmers, weil der Widerstandswert des Potis nicht mehr in Reihe zum Kondensator liegt. Bei einer dazwischen liegenden Einstellung des Potis wird die Resonanzspitze noch etwas stärker bedämpft, und die Resonanzfreqzenz sowie die obere Grenzfrequenz wandern ein wenig. Der Unterschied dürfte aber bei einem dermaßen dumpfen Ton kaum ins Gewicht fallen.
Mit zugedrücktem Auge kann man also sagen, der Klangregler stehe in der vorderen Position nicht zur Verfügung, obwohl sich an diesem Teil der Schaltung nichts ändert.
Nur Stellung 1 aus der Klangregelung rauszunehmen wäre auch schwer.
Ohne mir das jetzt aufmalen zu wollen, bräuchte man die Klangregelung nur auf den Stegtonabnehmer schalten, dann hätte sie außer in Stellung 1 überall Einfluß.

Nein, denn in der Mittelstellung ist ja ebenfalls nur der Hals-TA allein aktiv. Man könnte es aber wie folgt machen: Verbindung zwischen Volume und Tone trennen, die beiden unbelegten Kontakte unten links untereinander und mit Tone verbinden, den Kondensator ablöten und mit dem dritten Kontakt verbinden, den Kontakt ganz rechts mit dem Kontakt oben links verbinden und die beiden oberen rechten Kontakte untereinander verbinden.
Hätte Centralab Mitte des 20. Jahrhunderts dieselbe Idee gehabt wie einige japanische Schalterhersteller, dann würden wir heute vielleicht in allen Büchern über die Telecaster diese Schaltung vorfinden. Aber es kam anders, und Fender griff auf Schalter zurück, die keinen schaltbildnahen Aufbau ermöglichen. Was sich im Prinzipschaltbild einfach liest, führt dann im Montageplan zu unnötig langen Kabeln und unnötig häufigen Leitungskreuzungen. Also macht man es umgekehrt und entscheidet sich für einfache und vor allem kurze Kabelwege, die sich im Prinzipschaltbild etwas konfus lesen. Kurz schon deshalb, weil Fender auf eine optimale Abschirmung seiner Gitarren verzichtete, um unnötige Parallelkapazitäten zu vermeiden, die zu einem weniger brillianten Klang geführt hätten.
Typische japanische Schalter haben einen anderen Aufbau, der einer schaltbildnahen Verdrahtung entgegen kommt. Und so kommt es, dass Fender an seinen unterschiedlichen Produktionsstandorten verschiedene Versionen derselben Schaltung verwendet. Solange aber alle Versionen dieselben Tonabnehmerkombinationen usw. schaltbar machen, ist das für die Praxis nicht von Belang.
Vielleicht hat Leo Fender bei der Überarbeitung seiner Schaltung von Anfang an den Entwurf im Auge gehabt, der letztlich realisiert wurde, und beim Durchdenken der Schaltung an einer bestimmten Stelle losgeflucht. Falls dem so war, hat es ihn jedenfalls nicht davon abgehalten, der Schaltung trotzdem eine Chance zu geben. Und dann hat er beim Probezupfen entschieden, dass sich eine weitere Überarbeitung nicht lohnte.
 . A.R. Duchossoir schreibt in "The Fender Telecaster" (das gerade neben mir lag
. A.R. Duchossoir schreibt in "The Fender Telecaster" (das gerade neben mir lag