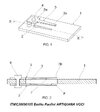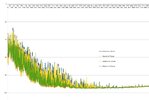J
jpascher
Registrierter Benutzer
Bin hier irrtümlicherweise auf einen falschen Aspekt eingegangen, es ging ja um die Kanalausformung. Beim Kanal lässt sich eindeutig sagen, dass der Obertoninhalt abnimmt, wenn dieser konisch nach hinten erweitert wird.Wie zeigen sich denn die klanglichen Unterschiede zwischen Stimmplatten mit konisch erweitertem Kanal gegenüber welchen ohne?
Wichtiger ist, dass der Obertongehalt bei sehr engen Spaltmaßen und parallelen Kanälen eine eher ungünstige Obertonzusammensetzung annimmt. Zumindest für mich klingt das nicht ansprechend.
Man sollte jedoch keine dramatischen Unterschiede erwarten. Ich würde vorschlagen, gezielt Wechselstimmstöcke mit unterschiedlichen Stimmsätzen einer Blindtestgruppe vorzuführen. Diese sollten dann bewerten, wie sich der Klang verhält. Meine Aussage beruht nur auf meinen Erfahrungen.
Zungen paralell oder konisch zulaufend:
Klanglich sehe ich wenig bis keinen Unterschied, da ich den Klang bei beiden Zungenformen ähnlich beeinflussen kann. Bei vergleichbarer Profilierung und gleichem Spaltmaß würde ich behaupten, dass es keinen Unterschied gibt. Ich müsste gezielt Vergleiche anstellen. Derzeit beruhen meine Aussagen nur auf den Erfahrungswerten ohne spezielle Tests. Ich habe dazu keine gezielten Tests durchgeführt, jedoch habe ich unterschiedliche Stimmsätze verwendet. Zum Beispiel gibt es von Cagnoni den HQ-Stimmsatz, dieser hat für etwa zwei Drittel aller Stimmplatten parallele Stimmzungen. Die Zungen sind auch etwas breiter als vergleichbare Töne mit konisch zulaufenden Zungen. Diese Stimmstätze sind etwas unausgewogen, da die Töne in den tiefen Lagen mehr Lautstärke bringen als in den hohen Lagen. Jedoch neigen die Töne ab einem bestimmten Tonbereich zu erhöhten Torsionsschwingungen und sind wesentlich schwieriger zu stimmen. Auch die DIX-Messur besitzt relativ viele Töne im unteren Bereich, die eine parallele Zunge besitzen. Ich persönlich finde parallele Zungen für Begleittöne und in Tonlagen, die noch tiefer klingen, optimal. Jedoch sind die überbreiten Zungen, die HQ-Stimmplatten aufweisen, nicht optimal, vor allem nicht bei den gewohnten Kanzellenbreiten, da auch die Anbringung der Ventile problematisch ist. Leider kann man nie komplett ausschließen, dass nicht andere Faktoren mitspielen, wie die Dicke der Stimmplatten, die Fußvernietung und die Kanalausformung. Es gibt genug Potenzial, weiter zu forschen. Wenn ich tiefe Töne nacharbeite, dann gelingt es mir leichter, diese zu optimieren, wenn sie nicht konisch zulaufen. Allein der Umstand, dass man eine Gewichtsverteilung anstrebt, die mehr Gewicht am beweglichen Ende besitzt, wird umso einfacher, je breiter das bewegliche Ende ist. Nachteilig ist, dass man bei parallelen Zungen das Spaltmaß nachträglich nur durch Zustemmen bzw. Beitreiben verringern kann. Bei konisch zulaufenden Zungen gelingt das wesentlich einfacher, indem man die Zungen nach vorne verschiebt und vorne etwas abfeilt. Klangänderungen können durch Veränderungen der Kanzelle erfolgen. Bleiben wir jedoch bei der Stimmplatte, so wird der Klang durch Veränderungen des Spaltmaßes, der Profilierung und der Kanalausformung beeinflusst. Neben diesen Faktoren gab es zumindest bei Harmoniumzungen die gängige Praxis, die Zungen zu intonieren. Dazu wurden spezielle Zangen verwendet, die der Zunge unterschiedliche Ausformungen aufprägten. Bei Akkordeons wird dies nicht gemacht, jedoch ergibt sich immer ein etwas unterschiedlicher Klang, wenn verschiedene Abschnitte der Zungen früher in den Kanal eintreten als andere. Aus meiner Sicht gibt es jedoch nur eine optimale Intonierung, also Formgebung in Ruheposition.
Zuletzt bearbeitet: